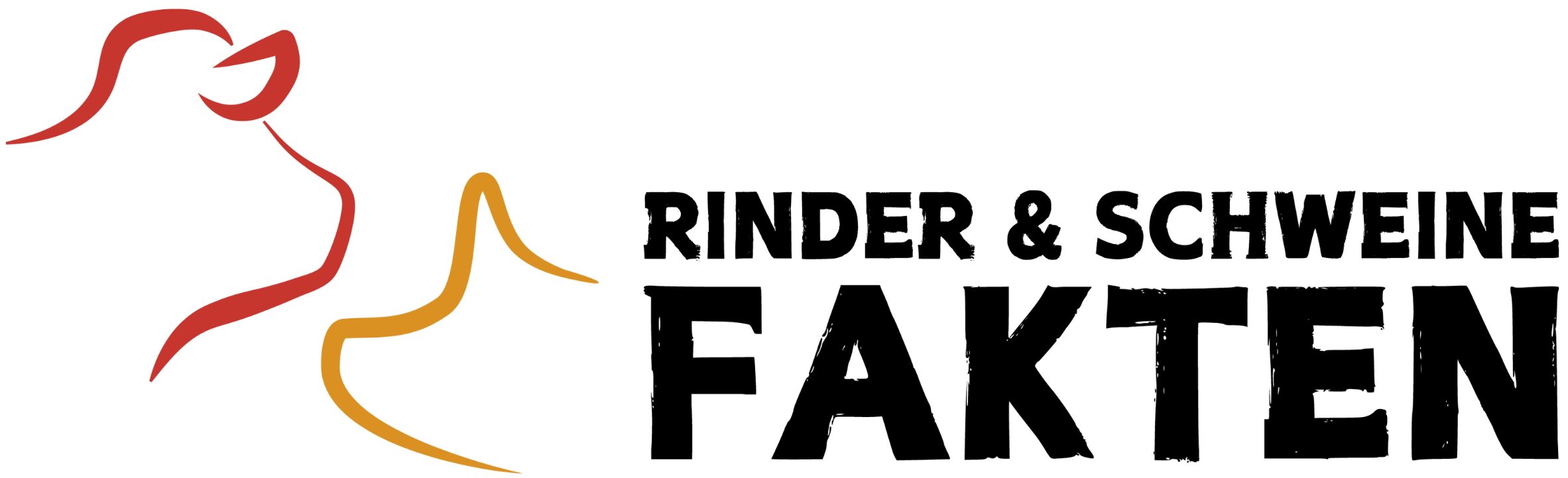Dialog Rind Schwein
Eine effiziente Milcherzeugung schont Ressourcen und das Klima

Die verfügbare landwirtschaftliche Nutzfläche wird weltweit ständig kleiner, da die Siedlungs- und Verkehrsfläche kontinuierlich ansteigt. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung und mit ihr auch der Bedarf nach hochwertigen Nahrungsmitteln. Immer mehr Menschen müssen von immer weniger landwirtschaftliche Nutzfläche ernährt werden. An einer nachhaltigen Intensivierung unserer Lebensmittelerzeugung geht daher kein Weg vorbei. Bei der Milcherzeugung gibt es international große Unterschiede, beispielsweise bei der Milchleistung je Kuh. Deutschland erzeugt jährlich rund 33 Mio. Tonnen Rohmilch und ist somit Spitzenreiter in Europa. Für diese Milchmenge werden in Deutschland 3,9 Mio. Milchkühe gehalten. Im Vergleich: Brasilien erzeugt mit knapp 36 Mio. Tonnen annähernd gleich viel Milch, hält hierfür aber über 15 Mio. Milchkühe.
Humanmedizin setzt große Mengen Reserveantibiotika ein

Das Auftreten resistenter Keime beim Menschen ist immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussion. Zuletzt stand im September dieses Jahres ein weitreichendes Verbot von bestimmten antimikrobiellen Wirkstoffklassen in der Tiermedizin zur Abstimmung. Sogenannte Reserveantibiotika sollen exklusiv für die Humanmedizin vorbehalten sein. Wie aus einer im MDPI Fachjournal Antibiotics
veröffentlichten Studie hervorgeht, werden in Deutschland beim Menschen beachtliche Mengen Reserveantibiotika verordnet. Demnach ist der deutsche humanmedizinische Verbrauch von Cephalosporinen im Vergleich zu Dänemark 80 bis 100 Mal höher. Der Verbrauch von Fluorchinolonen ist bei deutschen Humanmedizinern im Vergleich zu Großbritannien 2,3 bis 3,2 Mal höher.
Landwirtschaft: Klimawandelverursacher oder Retter?

Echt-Grün - Eure Landwirte: Der Klimawandel ist das beherrschende Thema unserer Zeit. Lange schien dieser noch sehr weit entfernt – bis jetzt. Ein einflussreicherFaktoren, wenn es um Klima, Umwelt und Artenschutz geht, ist die Landwirtschaf. Dem Beobachter der aktuellen Debatten in Politik und Gesellschaft stellen sich viele Fragen: Kann die Landwirtschaft den Klimawandel aufhalten? Oder hat Landwirtschaft überhaupt noch einen Platz in unserer heutigen Gesellschaft? Die Dokumentation SATT – Klimawandel. Landwirtschaft. Verantwortung.
stellt diese und weitere Fragen Vertretern von NGO, Landwirtschaft sowie Wissenschaft.
Gesundheit und Robustheit spielen in der modernen Rinderzucht die größte Rolle

Die Rinderrasse Deutsche Holsteins gehört zu den bekanntesten in der deutschen Milcherzeugung. Die schwarz-weiß oder rot-weiß gefleckten Kühe machen unter den in Deutschland gehaltenen Milchnutzungsrassen 95 Prozent aus. Die Zuchtziele haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stetig verändert. Noch bis zum Jahr 1996 war die Milchleistung das alleinige Zuchtziel. Heute hat sie hingegen nur noch einen Anteil von 36 Prozent am Gesamtzuchtwert. Die Gesundheit der Kuh, die Langlebigkeit sowie Merkmale des Körperbaus und ein unkomplizierter Geburtsverlauf machen den überwiegenden Anteil bei den Zielen der Rinderzucht aus. Auch die Kälberfitness hat eine hohe Bedeutung in der modernen Rinderzucht. Mit dieser Gewichtung der Zuchtwerte sollen gesunde Milchkühe mit ausgeglichenen körperlichen Merkmalen und Eigenschaften gezüchtet werden, die neben einer guten Milchleistung auch ein hohes Alter erreichen. Der Fokus der Zuchtziele liegt auf einer balancierten
Kuh. Das heißt, neben den Leistungsmerkmalen spielen Gesundheit und Robustheit eine immer größere Rolle.
Weide nicht automatisch besser für die Tiergesundheit

Weidehaltung gilt als besonders vorteilhaft für das Tierwohl. Wie das Informationsportal Oekolandbau.de erläutert, schneidet die Weidehaltung jedoch in Bezug auf die Tiergesundheit nicht besser ab als eine Stallhaltung mit Laufhof und zwar unabhängig von der Weidedauer. Die Kühe zeigten zwar bei regelmäßiger Weide tendenziell weniger klinische Lahmheiten und einen geringeren Verschmutzungsgrad, dafür wiesen die Herden mit zunehmenden Weidezeiten tendenziell mehr unterkonditionierte Kühe auf. Außerdem zeigte sich die Tendenz, dass bei den untersuchten Herden mit Ganzjahresstallhaltung oder wenig Weidegang mehr Kühe einen optimalen Fett-Eiweiß-Quotienten (FEQ) in der Milch aufwiesen. Auch würden seltener überhöhte Harnstoffwerte auftreten, was für eine ausgewogenere Futterration bei reiner Stallhaltung spricht. Grundsätzlich entscheide letztlich die Qualität des betrieblichen Managements darüber, ob das Potenzial der Weidehaltung für eine bessere Tiergesundheit und mehr Tierwohl genutzt werden kann.
Der Mann, der tierisches Methan vermindert

Michael Kreuzer, Professor für Tierernährung und Pionier in der Vermeidung von Treibhausgasemissionen bei Nutztieren, geht nach 27 Jahren an der ETH Zürich in Pension. Kreuzer war einer der ersten Wissenschaftler, die sich ernsthaft mit der Frage befassten, wie man das klimaschädigende Methangas von Wiederkäuern senken kann. Bei Rindern, Schafen und Ziegen bauen Bakterien die Pflanzenfasern im Pansen ab. «Dabei entsteht Wasserstoff, den das Tier entsorgen muss», erklärt Kreuzer. Das übernehmen methanogene Ur-Mikroben, in dem sie aus Wasserstoff und Kohlendioxid Methan herstellen, das Wiederkäuer übers Maul ausstossen.
«Der Clou ist, die Methanbildner zu hemmen, ohne die Verdauung der Fasern zu unterbinden», sagt Kreuzer. Er kennt in dieser Liga so ziemlich jeden Trick. Sein erster Versuch an der ETH war sein Schlüsselmoment: Er entdeckte, dass Kokosfett das Methan um bis zu 70 Prozent senken kann.
Whitepaper zur Klimaneutralen Rinderhaltung
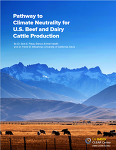
In einem Whitepaper informieren Dr. Sara E. Place, Elanco Animal Health
and Dr. Frank M. Mitloehner, University of California, Davis, über die Schritte zu einer Klima neutralen Rinderhaltung bis zum Jahr 2050. In der Zusammenfassung heißt es
- Der US-amerikanische Rindfleisch- und Milchsektor sollte sein Klimaziel Klimaneutralität statt Netto-Null-Kohlenstoff klarstellen und einen Punkt erreichen, an dem sie nicht mehr zur Erwärmung der Atmosphäre beitragen.
- Die Rindersektoren können bis 2050 Klimaneutralität, auch Netto-Null-Erwärmung genannt, erreichen, indem sie die Methanemissionen in den kommenden Jahrzehnten um 18-32 Prozent reduzieren.
- Business-as-usual wird es dem Sektor nicht ermöglichen, Klimaneutralität zu erreichen, sondern erfordert Innovation.
- Während das Ziel der Klimaneutralität US-Rind- und Milchviehbetriebe mit CO2-emittierenden Sektoren festlegt, die auf Null-Kohlenstoff-Emissionen abzielen, können Rinderbetriebe mit weiteren Emissionsreduzierungen über die Klimaneutralität hinausgehen und Teil einer Klimalösung sein.
Das Whitepaper steht zum Download zur Verfügung. Warum die Kuh kein Klimakiller ist, erklärt einer der Autoren, Prof. Frank Mitloehner, in diesem Video.
Hormone in der Milch: 6 Fakten

Milch ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel in Deutschland. Trotzdem ist dieses wertvolle Lebensmittel häufig Opfer von Mythen oder wird zum Anlass für wissenschaftlich nicht tragbare Behauptungen genutzt, um Verbrauchern Angst zu machen. Ein Vorurteil dreht sich dabei um den natürlichen Hormongehalt und mögliche Gesundheitsrisiken. Der Ernährungswissenschaftler und Lebensmittelchemiker Morten Elsoe hat sich diesem Thema gewidmet und hinterfragt die 6 häuftigsten Vorurteile.
Wege zur Klimaneutralität für die Rindfleisch- und Milchviehproduktion in den USA

Der US-amerikanische Rindfleisch- und Milchsektor kann die Klimaneutralität, die auch als Netto-Null-Erwärmung bezeichnet wird, bis 2050 erreichen, indem er die Methanemissionen in den kommenden Jahrzehnten um 18-32 Prozent reduziert. Mit Business-as-usual
wird der Sektor dies allerdings nicht erreichen können, sondern es sind Innovationen erforderlich. Während das Ziel der Klimaneutralität die US-Rind- und Milchwirtschaft auf eine Stufe mit den CO2-emittierenden Sektoren stellt, die eine Netto-Null-Kohlenstoffemission anstreben, können die Rinderbetriebe mit weiteren Emissionssenkungen über die Klimaneutralität hinausgehen und Teil einer Klimalösung sein.
„Haferdrink ist nichts weiter als sehr viel Wasser mit sehr wenig Hafer"
Haferdrinks sind dreimal so teuer wie Kuhmilch. An den Inhaltstoffen kann es nicht liegen. Und auch nicht an den Herstellungkosten. Warum Hafermilch trotzdem so viel mehr kostet als Kuhmilch, erklärt der Journalist Dr. Olfa Zinke in agrarheute
. Es wird als ideales Anti-Klima-Getränk verkauft, was es eigentlich nicht ist, wenn man die Nährstoffdichte zugrunde legt.
Dieselbe Beobachtung lässt sich für alternative Proteinnahrungsmittel, z.B. Würmer, machen. 18-Gramm-Packungen Buffolo-Würmer kosten um die 6,99 Euro, 100 Gramm kosten rd. 39 Euro. Bezogen auf den Proteingehalt müsste Schweinefleisch (je nach Teilstück) demnach im Mittel rd. 12 Euro je 100 Gramm kosten. Tatsächlich kosten 100 Gramm nur 50 Cent.